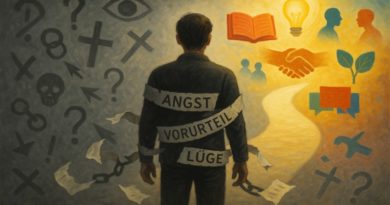DFG bewilligt 13 neue Sonderforschungsbereiche
Innovationsmotor für Wissenschaft und Gesellschaft
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) investiert erneut zielgerichtet in die Zukunft der deutschen Wissenschaftslandschaft: Ab Oktober 2025 werden deutschlandweit 13 neue Sonderforschungsbereiche (SFB) eingerichtet, die mit einer Gesamtfördersumme von rund 177 Millionen Euro ausgestattet sind. Die erste Förderphase ist auf drei Jahre und neun Monate angelegt, mit Option auf eine Verlängerung auf bis zu zwölf Jahre.
Diese Entscheidung unterstreicht den strategischen Ansatz der DFG, exzellente, interdisziplinäre und langfristige Forschungsverbünde zu fördern, die nicht nur wissenschaftliche Exzellenz stärken, sondern auch gesellschaftliche Innovationen ermöglichen.
Was sind Sonderforschungsbereiche (SFB)?
Sonderforschungsbereiche (SFBs) sind das Flaggschiff der deutschen Forschungsförderung. Sie bieten Hochschulen die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum mit grundlegenden, komplexen wissenschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen. Diese Forschungsverbünde zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: SFBs vereinen Expert*innen aus verschiedenen Fachrichtungen.
- Standortübergreifende Projekte: Häufig sind mehrere Universitäten beteiligt.
- Langfristige Perspektiven: Bis zu zwölf Jahre Förderung für nachhaltige Forschung.
- Freiheit für kreative Ideen: Risikoreiche, innovative Ansätze stehen im Fokus.
SFBs tragen maßgeblich zur Profilbildung von Hochschulen bei und stärken deren internationale Sichtbarkeit.
Die neuen Sonderforschungsbereiche 2025 – Themen und Highlights
Die 13 neuen SFBs decken ein breites Spektrum an Forschungsfeldern ab – von medizinischen Grundlagen über Material- und Umweltforschung bis hin zu kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen. Hier ein Überblick über besonders herausragende Projekte:
1. Circadiane Medizin (Charité Berlin)
Untersuchung, wie die innere biologische Uhr Gesundheit und Krankheitsverläufe beeinflusst – mit dem Ziel, neuartige zeitabhängige Therapien zu entwickeln.
2. Fettleber und Stoffwechselerkrankungen (Charité Berlin, TU Dresden)
Forschung zu den Ursachen der nicht-alkoholischen Fettleber und Entwicklung von individualisierten Therapieformen.
3. Nanomaterialien und Heterostrukturen (Freie Universität Berlin)
Entwicklung neuer Materialien durch Kombination von Molekülen mit zweidimensionalen Materialien wie Graphen.
4. Verkehrsplanung der Zukunft (TU Dresden, TU München)
Entwicklung datengestützter, agiler Mobilitätskonzepte für eine nachhaltige, gerechte und stadtverträgliche Verkehrsplanung.
5. Gedruckte Halbleiter (Universität Erlangen-Nürnberg)
Erforschung der ressourcenschonenden Herstellung von Halbleitermaterialien mittels Drucktechnologien – eine Alternative zur klassischen Chipproduktion.
6. Darmkrebs: Zellkommunikation und Therapien (Universität Frankfurt)
Analyse von Kommunikationsprozessen in Tumorzellen zur Entwicklung zielgerichteter Therapien gegen kolorektale Karzinome.
7. Kohlenstoffbindung im Ozean (Universität Greifswald)
Forschung an Meeresalgen und Mikroorganismen zur CO₂-Speicherung – ein möglicher Schlüssel zum Klimaschutz.
8. Mütterliche Immunaktivierung in der Schwangerschaft (Universität Hamburg)
Erforschung der Immunantwort während der Schwangerschaft und deren Auswirkungen auf das ungeborene Kind.
9. Plastizität von Krebszellen (Universität Heidelberg)
Wie passen sich Krebszellen an Therapien an? Ziel ist die Entwicklung von Strategien zur Überwindung von Resistenzen.
10. Nierenzellforschung: Podozyten im Fokus (Universität Köln)
Untersuchung von Podozyten, spezialisierten Zellen der Niere, und deren Rolle bei chronischen Nierenerkrankungen.
11. Simulationsbasiertes Lernen (LMU München)
Entwicklung personalisierter Simulationen zur Verbesserung der Ausbildung in Medizin und Pädagogik.
12. Kommunikation und Common Ground (Universität Tübingen)
Wie entsteht geteiltes Wissen im Alltag? Erforschung von Kommunikationsprozessen in verschiedenen sozialen Kontexten.
Bedeutung für Wissenschaft, Bildung, Medizin und Gesellschaft
Mit der Förderung dieser neuen Sonderforschungsbereiche setzt die DFG ein starkes Zeichen für zukunftsorientierte Wissenschaftspolitik. Die Projekte leisten einen entscheidenden Beitrag zu:
- medizinischen Innovationen (z. B. in der Krebs-, Leber- und Nierenforschung),
- nachhaltigen Technologien (z. B. Halbleiterdruck, CO₂-Bindung im Ozean),
- Bildungstransfer und Digitalisierung (Simulationen, Kommunikation),
- und nicht zuletzt zur internationalen Sichtbarkeit deutscher Hochschulforschung.
Diese Forschungsinitiativen stehen exemplarisch für die Frage: Wie kann Wissenschaft zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen?
Weiterführende Informationen
Eine vollständige Übersicht über alle geförderten Projekte, beteiligte Institutionen sowie Ansprechpartner*innen finden Sie auf der offiziellen Webseite der DFG: www.dfg.de/sfb
Fazit: Starke Impulse für die deutsche Forschungslandschaft
Die neuen Sonderforschungsbereiche 2025 zeigen, wie vielfältig, relevant und gesellschaftlich wirksam die Spitzenforschung in Deutschland ist. Sie stärken den Wissenschaftsstandort Deutschland und bieten Raum für exzellente Grundlagenforschung mit Anwendungsperspektive – von der molekularen Medizin bis zur urbanen Mobilität.
Wissenschaftliche Neugier trifft auf gesellschaftliche Verantwortung – gefördert durch die DFG.