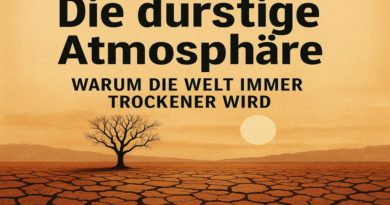Der Eklat um die Richterwahl – Wie Politik und Gesellschaft an einer Personalie zu zerbrechen drohen
Was sich in den letzten Wochen rund um die Richterwahl im Deutschen Bundestag abspielte, ist nicht bloß eine politische Panne. Es ist ein Weckruf – ein unüberhörbares Alarmsignal für den Zustand unserer parlamentarischen Kultur, unserer demokratischen Institutionen und nicht zuletzt unserer gesellschaftlichen Debattenfähigkeit. Die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichterin markiert den vorläufigen Tiefpunkt eines Prozesses, der längst aus dem Ruder gelaufen ist – und Sie als Bürgerin oder Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, was hier wirklich auf dem Spiel steht.
Vom Konsens zur Konfrontation – Der politische Prozess gerät aus den Fugen
Was einst als Routineakt parlamentarischer Zusammenarbeit galt – die parteiübergreifende Wahl von Richterinnen und Richtern für das höchste deutsche Gericht – wurde zur Bühne ideologischer Blockade. Dabei stand der neue Koalitionsstil noch zu Jahresbeginn unter einem anderen Stern: Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eine Phase der „neuen Vernunft“ angekündigt, ein Ende parteitaktischer Spielchen. Doch diese Worte sind längst verblasst.
Die CDU/CSU verweigerte der SPD-Kandidatin Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit – nicht etwa wegen juristischer Mängel, sondern wegen ihrer öffentlich vertretenen Auffassungen zu reproduktiven Rechten, insbesondere dem Schwangerschaftsabbruch, sowie ihrer Haltung zum Verhältnis von Grundrechten und Staatsintervention.
Die Union spricht von berechtigten „inhaltlichen Vorbehalten“. Die SPD hingegen nennt das Vorgehen eine „gezielte Diskreditierung“ – ein Ausdruck politischer Instrumentalisierung auf Kosten der Verfassungsinstitution.
Die Hauptakteure – Verantwortungslosigkeit auf beiden Seiten
Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der Union, steht in der Kritik, das Vertrauen innerhalb der Koalition verspielt und eine einmal getroffene Absprache eigenmächtig torpediert zu haben. Aus seiner Fraktion wurde der Vorwurf laut, die Abstimmung sei ohne hinreichende Rücksprache durchgepeitscht worden – ein Indiz für Führungsschwäche oder bewusste Sabotage?
Frauke Brosius-Gersdorf ist eine renommierte Verfassungsrechtlerin, Professorin an der Leibniz Universität Hannover, Mitglied zahlreicher ethischer Gremien und Autorin grundlegender Schriften zum Gleichheitsgrundsatz. Ihre wissenschaftliche Integrität wurde von keiner Seite angezweifelt. Doch ihre dezidiert liberalen Positionen in gesellschaftspolitischen Fragen rufen den Widerstand konservativer und rechtspopulistischer Strömungen auf den Plan. Der Ton der Auseinandersetzung gegen sie war oft persönlich, diffamierend und unsachlich – einer Demokratie unwürdig.
SPD und CDU/CSU wiederum versäumen es bislang, ihrer gemeinsamen Verantwortung für das Gemeinwohl gerecht zu werden. Statt im Dialog Lösungen zu suchen, verfestigen sie das Bild eines zutiefst gespaltenen Regierungsapparates.
Die institutionelle Dimension – Gefährliches Spiel mit dem Ansehen des Verfassungsgerichts
Die Wahl von Richterinnen und Richtern an das Bundesverfassungsgericht erfordert laut Grundgesetz eine Zwei-Drittel-Mehrheit – bewusst, um parteipolitische Dominanz auszuschließen. Dieses Modell lebt von Vertrauen, Integrität und Kompromissbereitschaft. Wird dieses Prinzip durch parteitaktisches Kalkül ausgehöhlt, steht weit mehr auf dem Spiel als eine Personalie: Es geht um das Ansehen und die Unabhängigkeit des höchsten Gerichts der Bundesrepublik.
Wenn nun politische Erwägungen die Auswahl beeinflussen, wenn Bewerberinnen aufgrund ihrer Meinung zu verfassungsrechtlich zulässigen Positionen aussortiert werden, dann gefährden Sie nicht nur die Gewaltenteilung, sondern untergraben das Vertrauen in den Rechtsstaat selbst.
Wie geht es weiter? – Vier Szenarien, kein klares Ziel
Im Raum stehen mehrere Möglichkeiten:
- Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU – verbunden mit der Nominierung einer konsensfähigen Ersatzperson. Doch hier droht Gesichtsverlust auf beiden Seiten.
- Festhalten an Brosius-Gersdorf durch die SPD – ein symbolischer Akt, der den Konflikt weiter eskalieren könnte.
- Blockadehaltung und Verschiebung – mit unkalkulierbaren Folgen für anstehende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.
- Einbeziehung des Bundesrats, sollte im Bundestag dauerhaft keine Einigung erzielt werden – ein seltener, aber verfassungsrechtlich vorgesehener Notausgang.
Keines dieser Szenarien verspricht eine rasche Beruhigung der Lage. Vielmehr ist die Gefahr groß, dass der Schaden bereits irreparabel ist – zumindest für die politische Kultur.
Fazit – Sie müssen sich fragen: Wie lange kann das noch gut gehen?
Der Streit um die Richterwahl ist nicht bloß ein weiteres Kapitel parteipolitischer Ränkespiele. Er ist ein Gradmesser dafür, wie sehr sich die politische Elite von demokratischen Grundsätzen entfernt hat. Die Koalition – und das gilt für beide Seiten – steht in der Pflicht, Schaden vom Ansehen der Institutionen abzuwenden. Die Personalfrage muss auf Grundlage von Qualifikation und Integrität entschieden werden, nicht nach moralpolitischer Gesinnung.