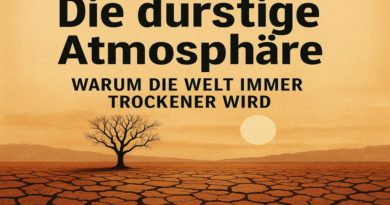Trumps Zölle und das historische Déjà-vu
Protektionismus und seine Folgen: Was Herbert Hoover und Donald Trump gemeinsam haben – und was nicht
Die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten bietet viele lehrreiche Beispiele – eines der eindrücklichsten ist der Umgang mit protektionistischen Maßnahmen in Krisenzeiten. In diesem Artikel wird ein kritischer Vergleich zwischen der Zollpolitik von Präsident Herbert Hoover Anfang der 1930er-Jahre und derjenigen von Donald Trump im 21. Jahrhundert gezogen. Dabei stellt sich die Frage: Was sind die Folgen von Protektionismus, und welche Lehren lassen sich aus der Geschichte für die Gegenwart ziehen?
Das Smoot-Hawley-Zollgesetz unter Präsident Hoover – ein historischer Wendepunkt
Am 17. Juni 1930 unterzeichnete der damalige US-Präsident Herbert Hoover das sogenannte Smoot-Hawley Tariff Act. Dieses Gesetz hob die Importzölle auf über 20.000 Produkte auf ein Rekordniveau an. Ziel war es, die heimische Wirtschaft während der Großen Depression zu schützen und amerikanische Arbeitsplätze zu sichern.
Doch die Maßnahme hatte verheerende Auswirkungen:
- Der Welthandel schrumpfte bis 1933 um rund 60 %.
- Die US-Importe fielen um 66 %, die Exporte sogar um bis zu 70 %.
- Viele Länder reagierten mit eigenen Schutzzöllen – ein globaler Handelskrieg entbrannte.
- Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg bis 1932 auf 25 %, während Einkommen und Konsum massiv einbrachen.
Hoovers Wirtschaftspolitik wurde scharf kritisiert – sowohl von führenden Industriellen wie Henry Ford als auch von Ökonomen. Sie gilt als ein Beispiel dafür, wie protektionistische Maßnahmen in Krisenzeiten unbeabsichtigte Nebenwirkungen entfalten können. 1932 verlor Hoover die Präsidentschaftswahl gegen Franklin D. Roosevelt, dessen „New Deal“ eine wirtschaftliche Wende einleitete.
Donald Trump: Ein moderner Protektionist?
Fast ein Jahrhundert später verfolgte Präsident Donald Trump einen ähnlichen Ansatz. Im Zuge seiner „America First“-Politik führte er zahlreiche Zölle auf Importe aus Ländern wie China, Mexiko oder der EU ein. Seine Begründung: die heimische Industrie stärken, Arbeitsplätze zurückholen und angeblich „unfaire Handelspraktiken“ korrigieren.
Die wirtschaftlichen Reaktionen auf Trumps Zollpolitik zeigten jedoch erneut die Risiken protektionistischer Maßnahmen:
- Die Finanzmärkte reagierten nervös auf zunehmende Handelskonflikte.
- Länder wie China setzten Gegenzölle durch – besonders auf US-Agrarprodukte.
- Globale Lieferketten wurden unterbrochen, was zu steigenden Produktionskosten und Unsicherheiten in exportorientierten Branchen führte.
Ob die langfristigen Folgen von Trumps Zollpolitik ebenso dramatisch ausfallen wie in der Ära Hoover, ist noch nicht abschließend zu beurteilen. Doch bereits jetzt zeigt sich: Auch heute können einseitige Handelsbarrieren erhebliche Schäden in einer stark vernetzten Weltwirtschaft verursachen.
Parallelen und Unterschiede zwischen damals und heute
Obwohl zwischen Hoover und Trump fast 100 Jahre liegen, lassen sich klare Parallelen erkennen: Beide verfolgten protektionistische Maßnahmen, um in Krisenzeiten kurzfristige Vorteile für die eigene Wirtschaft zu erzielen. Doch es gibt auch entscheidende Unterschiede:
- In Hoovers Zeit war der internationale Handel deutlich weniger globalisiert. Heute sind Lieferketten international verflochten und Abhängigkeiten komplexer.
- Die Weltwirtschaft ist heute stärker reguliert und multilaterale Handelsinstitutionen wie die WTO versuchen, Eskalationen zu begrenzen.
- Die Geschwindigkeit, mit der sich Märkte heute aufgrund digitaler Technologien verändern, verstärkt die Auswirkungen protektionistischer Eingriffe zusätzlich.
Warum Protektionismus heute wieder an Bedeutung gewinnt
Die Rückkehr des Protektionismus ist kein Zufall – sie ist Ausdruck globaler Unsicherheiten und gesellschaftlicher Spannungen. Zu den Hauptgründen zählen:
- Globalisierungskritik: Viele Menschen fühlen sich durch den internationalen Wettbewerb wirtschaftlich benachteiligt. In westlichen Industrienationen sind industrielle Arbeitsplätze in den letzten Jahrzehnten zunehmend ins Ausland abgewandert.
- Populismus: Politiker nutzen protektionistische Rhetorik, um sich als Verteidiger „der kleinen Leute“ zu inszenieren. Dies geschieht häufig auf Kosten einer differenzierten Debatte über wirtschaftliche Zusammenhänge.
- Geopolitische Spannungen: Handelszölle werden heute auch als politische Machtinstrumente eingesetzt – wie etwa im Handelskonflikt zwischen den USA und China.
- Industriepolitische Strategien: Staaten versuchen, Schlüsselindustrien wie die Halbleiter- oder Energiebranche durch protektionistische Maßnahmen gezielt zu fördern.
Fazit: Protektionismus ist populär – aber selten nachhaltig
Die historischen Erfahrungen rund um das Smoot-Hawley-Zollgesetz zeigen deutlich, dass Handelsbarrieren in Krisenzeiten das Gegenteil dessen bewirken können, was beabsichtigt ist. Auch die jüngeren Entwicklungen unter Donald Trump verdeutlichen: Protektionismus mag kurzfristig politisch attraktiv erscheinen, langfristig gefährdet er jedoch wirtschaftliche Stabilität, globale Partnerschaften und Innovationsfähigkeit.
In einer zunehmend interdependenten Weltwirtschaft ist der Ruf nach fairen Handelspraktiken berechtigt – doch dieser sollte nicht mit nationalen Alleingängen beantwortet werden. Nachhaltige Wirtschaftspolitik braucht multilaterale Kooperation, Transparenz und eine kluge Balance zwischen Wettbewerbsschutz und internationaler Zusammenarbeit.