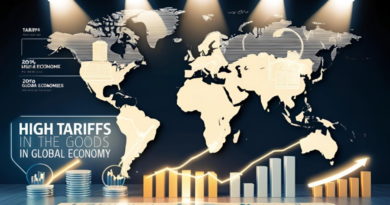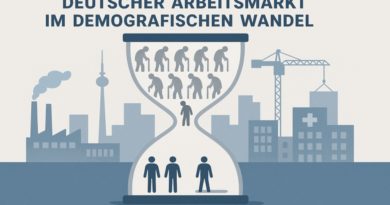Geldmenge, Inflation und Gold: Die Fakten, die Sie 2025 kennen sollten
Die globale Geldmenge M2 der vier größten Zentralbanken – USA (Federal Reserve), Europa (EZB), Japan (BoJ) und China (PBoC) – beläuft sich derzeit auf über 90 Billionen US-Dollar. Nach den extremen Ausweitungen in den Jahren 2020 bis 2022, die vor allem pandemiebedingt erfolgten, hat sich das Wachstum inzwischen deutlich verlangsamt. Die M2-Wachstumsrate liegt 2025 unter dem langjährigen Durchschnitt, was eine gewisse geldpolitische Normalisierung signalisiert. Dennoch bleibt das absolute Niveau historisch hoch, was strukturelle Auswirkungen auf Kapitalmärkte, Kreditvergabe und Investitionsentscheidungen hat.
US-Geldpolitik zwischen Straffung und Lockerung
Die US-Notenbank Fed befindet sich offiziell weiterhin in einem Prozess des Quantitative Tightening (QT), d. h. sie reduziert ihre Bilanzsumme, indem auslaufende Staatsanleihen nicht ersetzt werden. Gleichzeitig kam es jedoch im Mai 2025 zu verdeckten Liquiditätsspritzen: Die Fed kaufte an mehreren Handelstagen US-Staatsanleihen im Umfang von rund 44 Milliarden US-Dollar zurück. Solche Schritte werden als „Stealth QE“ bezeichnet – eine Form stiller geldpolitischer Lockerung, die faktisch Liquidität ins System zurückführt, auch wenn sie nicht offiziell als neues Anleihekaufprogramm deklariert ist. Damit zeigt sich, wie stark die Fed zwischen Inflationsbekämpfung und der Stabilisierung der Finanzmärkte balancieren muss.
Staatsverschuldung als strukturelles Risiko
Die US-Staatsverschuldung übersteigt mittlerweile 37 Billionen US-Dollar, was rund 119 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Das Verhältnis von Schulden zu Wirtschaftsleistung erreicht damit historische Spitzenwerte. Besonders problematisch sind die Zinslasten: Bereits heute fließen mehr als ein Sechstel der US-Haushaltsausgaben in Schuldendienste, Tendenz steigend. Für die kommenden Jahre gilt die Dynamik der Verschuldung als eines der größten makroökonomischen Risiken weltweit.
Inflation und reale Vermögenswerte
Expansive Geldpolitik, hohe Staatsschulden und ein nachlassendes Vertrauen in die Bonität westlicher Staatsanleihen bilden einen Nährboden für Inflationsrisiken. Auch wenn die offiziellen Verbraucherpreisindizes in den USA und Europa Anfang 2025 wieder in den Bereich von 2–3 % gefallen sind, bleibt die strukturelle Gefahr erhöht. Rohstoffe und Sachwerte profitieren in diesem Umfeld: Vor allem Gold verzeichnet eine starke Nachfrage. Das Edelmetall erreichte im Frühjahr 2025 ein Allzeithoch von über 3.500 US-Dollar pro Feinunze, was inflationsbereinigt ebenfalls nahe historischen Rekorden liegt.
Gold als strategische Reserve
Besonders bemerkenswert ist die Nachfrage der Zentralbanken: Sie kaufen auch 2025 hohe Mengen Gold, um ihre Währungsreserven zu diversifizieren und sich gegen geopolitische wie währungspolitische Risiken abzusichern. Prognosen gehen von einem Jahresvolumen von knapp 1.000 Tonnen aus – ein Wert, der nahe an den Rekorden der letzten Jahre liegt. Dieser Trend bestätigt die Funktion von Gold nicht nur als Krisenmetall, sondern auch als geopolitische Absicherung für Staaten.
Handlungsempfehlung
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre belegen, dass Gold in Zeiten hoher Unsicherheit als strategischer Inflationsschutz und langfristiges Wertaufbewahrungsmittel dient. Anleger sollten sich der Sensibilität der Märkte gegenüber Liquiditätsschwemmen, Staatsverschuldung und geldpolitischen Richtungswechseln bewusst sein. Wer sich gegen strukturelle Risiken absichern möchte, findet in Gold eine bewährte Anlageklasse – allerdings sinnvoll eingebettet in ein diversifiziertes Portfolio, das auch andere reale Werte wie Rohstoffe, Immobilien oder inflationsgeschützte Anleihen berücksichtigen kann.