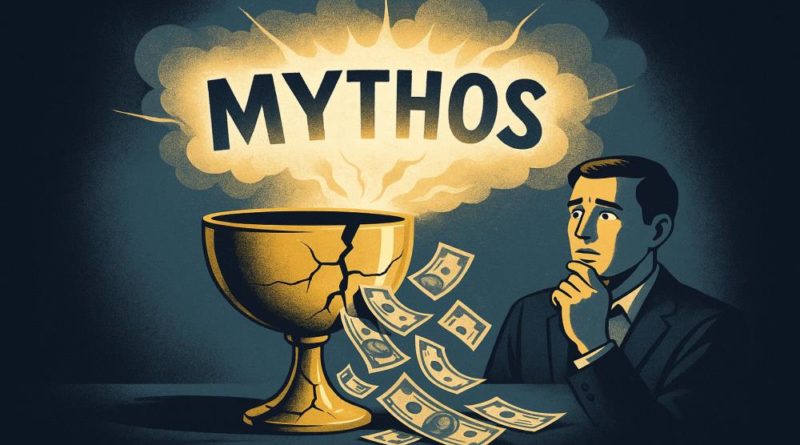Der Dividenden-Mythos im Faktencheck und zeitgemäßer Einordnung
Einleitung
Für viele Privatanleger gelten Dividenden als Inbegriff eines soliden Vermögensaufbaus: regelmäßige Ausschüttungen, ein scheinbar planbares Nebeneinkommen und die Vorstellung vom „passiven Einkommen“ durch Aktienbesitz. Finanzblogs, YouTube-Kanäle und soziale Netzwerke verstärken diese Wahrnehmung.
Doch wie belastbar ist dieses Narrativ? Der Vermögensberater Nikolaus Braun stellt eine provokante These auf: Die weitverbreitete Dividendenstrategie sei überbewertet – und fordert eine sachliche Überprüfung einer der populärsten Investmentansätze unserer Zeit.
Was steckt hinter dem Dividenden-Mythos?
Verbreitete Annahmen:
- Regelmäßige Einnahmen: Dividenden werden als planbare Einkommensquelle angesehen.
- Passives Einkommen: Kein Verkauf nötig, Kapital bleibt bestehen.
- Krisenresistenz: Dividendenwerte gelten als stabile Anker in unsicheren Zeiten.
Kritische Gegenargumente:
- Keine echte Wertschöpfung: Dividenden mindern den Aktienkurs um den Auszahlungsbetrag – ein bilanzieller Transfer, kein Wertzuwachs.
- Wirtschaftliche Unsicherheit: Unternehmen kürzen in Krisen die Dividende – zuletzt sichtbar während der Pandemie.
- Innovationsfalle: Wachstumsfirmen wie Alphabet, Amazon oder Tesla verzichten auf Ausschüttungen – und erzielen dennoch hohe Kursgewinne.
- Hohe Einstiegshürden: Nur mit sehr hohem Vermögen sind Dividenden als Lebensunterhalt tragfähig. Nach Steuern und Inflation bleibt der reale Ertrag oft begrenzt.
Psychologische Aspekte hinter der Dividendenliebe
- Sicherheitsempfinden: Regelmäßige Zahlungen schaffen Vertrauen und Struktur.
- Vergleich zur Miete: Dividenden wirken wie „Zinszahlungen“ auf das eigene Kapital.
- Erfolgserzählungen: Influencer und Blogs betonen positive Einzelgeschichten – oft ohne Verweis auf Risiken.
Die Realität: Woran erkennt man Qualität?
- Eine hohe Dividendenrendite ist nicht zwangsläufig positiv – sie kann auf mangelnde Investitionsperspektiven oder bilanzielle Schwächen hinweisen.
- Qualität zeigt sich stattdessen durch nachhaltiges Gewinnwachstum, Innovationsfähigkeit und langfristige Wettbewerbsstärke.
Forschung & Datenlage
Pro-Dividende:
- Historisch trugen Dividenden wesentlich zur Gesamtrendite bei – insbesondere in stagnierenden Marktphasen.
- Unternehmen mit stabiler Ausschüttung zeigen oft robuste Geschäftsmodelle.
- In Niedrigzinsphasen bieten Dividenden einen realen Ertragsanker.
Contra-Dividende:
- Steuerliche Nachteile: Dividenden sind sofort steuerpflichtig, Kursgewinne lassen sich langfristig optimieren.
- Performance-Frage: „Dividendenaristokraten“ überzeugen mehr durch Konstanz als durch Wachstumsdynamik.
- Kapitalallokation: Ausschüttungen können zulasten von Zukunftsinvestitionen gehen.
Aktuelle Entwicklungen (Stand 2025)
- Mittelmäßige Performance: Klassische Dividendenstrategien bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück.
- Tech-Firmen im Fokus: Große Marktführer investieren Gewinne lieber ins Wachstum.
- Steuerlicher Shift: Nicht realisierte Kursgewinne sind in Deutschland attraktiver als laufende Dividenden.
- Inflationsdruck: Bleibt die Dividende statisch, sinkt die reale Rendite.
- Substanzschäden: Unternehmen, die Ausschüttungen auf Pump finanzieren, gefährden langfristig ihr Geschäftsmodell.
Fazit: Wie sollten Anleger heute mit Dividenden umgehen?
- Dividenden sind kein verlässliches Qualitätsmerkmal. Wer ausschließlich auf Ausschüttung fokussiert, vernachlässigt Innovationskraft und Wachstumschancen.
- Die sinnvollere Strategie liegt oft in einem ganzheitlichen Portfolioansatz mit Fokus auf langfristige Unternehmensentwicklung.
- Dividenden können in bestimmten Lebensphasen – etwa im Ruhestand – hilfreich sein, sollten aber im Aufbau von Vermögen nicht im Zentrum stehen.
„Dividenden sind ein Werkzeug, kein Allheilmittel. Wer sie jagt, ignoriert oft den Weg, auf dem nachhaltiger Vermögensaufbau wirklich gelingt.“ – Nikolaus Braun
Empfehlung für Einsteiger
Wer dennoch nicht auf Dividenden verzichten möchte, kann mit einem global breit aufgestellten ETF wie dem MSCI World High Dividend Yield beginnen – als Beimischung, nicht als Hauptstrategie.