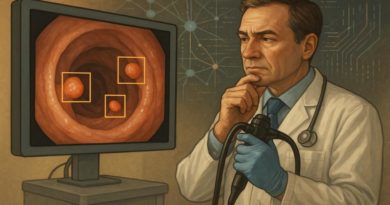Sonnencreme und Krebsrisiko – Was stimmt wirklich?
Einleitung: Sonne, Schutz und Unsicherheit
Sonnencremes gehören für viele Menschen zur täglichen Hautpflege im Sommer – und zunehmend auch ganzjährig. Doch immer wieder kursieren in sozialen Medien alarmierende Behauptungen: Sonnencremes seien angeblich krebserregend, enthielten hormonaktive Stoffe oder schadeten mehr, als sie nützen. Was ist dran an diesen Aussagen? In diesem Artikel werfen wir einen wissenschaftlich fundierten Blick auf die wichtigsten Fakten und Mythen.
1. Behauptung: Verursacht Sonnencreme wirklich Krebs?
Was sagt die Wissenschaft?
In der Tat enthalten viele Sonnencremes synthetische UV-Filter wie Oxybenzon, Octocrylen oder Avobenzon. Einige dieser Stoffe konnten in Studien im Blut oder Urin von Probanden nachgewiesen werden. Doch das allein bedeutet noch nicht, dass sie gesundheitsschädlich oder gar krebserregend sind. Entscheidend ist die Konzentration, in der diese Substanzen aufgenommen werden, und ob sie tatsächlich biologisch wirksam sind.
Die Fakten:
- Die verwendeten Filter unterliegen in der EU (z. B. durch die EU-Kosmetikverordnung) und den USA (z. B. durch die FDA) strengen Sicherheitsprüfungen.
- Für Oxybenzon zeigen Studien zwar eine geringe systemische Aufnahme, aber kein belastbarer Zusammenhang mit Krebs beim Menschen konnte bisher nachgewiesen werden.
- Octocrylen, ein weiterer kritischer UV-Filter, kann sich in alten Produkten zu Benzophenon zersetzen – eine Substanz, die von der IARC als „möglicherweise krebserregend beim Menschen“ (Gruppe 2B) eingestuft wird. Dies betrifft vor allem abgelaufene oder schlecht gelagerte Produkte.
Wichtig: Verbraucher*innen sollten bei Sonnencremes auf das Haltbarkeitsdatum achten und Produkte nach Ablauf entsorgen – insbesondere, wenn sie Octocrylen enthalten.
2. Reicht der natürliche Schutz der Haut aus?
Die Haut besitzt tatsächlich gewisse Abwehrmechanismen gegen UV-Strahlung, etwa durch die Bildung von Melanin (Bräunung) oder eine Verdickung der Hornschicht bei regelmäßiger Sonnenexposition. Doch diese Schutzbarrieren sind begrenzt, setzen erst nach wiederholter UV-Belastung ein und schützen gerade hellhäutige Menschen nicht zuverlässig.
Schon nach wenigen Minuten in intensiver Sonne kann es zu DNA-Schäden in Hautzellen kommen. Die WHO stuft UV-Strahlung (UVA, UVB) daher zu Recht als „eindeutig krebserregend“ (Gruppe 1) ein.
3. Wie funktioniert Sonnencreme?
Sonnencremes basieren auf zwei Arten von UV-Filtern:
- Chemische Filter (z. B. Avobenzon, Octocrylen): Diese ziehen in die oberste Hautschicht ein und wandeln UV-Strahlung in Wärme um.
- Physikalische Filter (z. B. Zinkoxid, Titandioxid): Sie bleiben auf der Hautoberfläche und reflektieren oder streuen die UV-Strahlen.
Moderne Produkte bieten meist Breitbandschutz, das heißt: Sie schützen sowohl vor UVB-Strahlen (verantwortlich für Sonnenbrand) als auch vor UVA-Strahlen (tiefer eindringend, für Hautalterung und Krebs mitverantwortlich).
Der Lichtschutzfaktor (LSF/SPF) gibt an, um welchen Faktor sich die Eigenschutzzeit der Haut verlängert. Ein LSF 30 bedeutet etwa den 30-fachen Schutz gegenüber ungeschützter Haut – bei korrekter Anwendung!
4. Hautkrebs nimmt zu – trotz mehr Sonnencreme?
Ein scheinbares Paradoxon: Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt seit Jahrzehnten, obwohl Sonnenschutzmittel heute weit verbreitet sind.
Die Gründe:
- Langsame Entstehung: Hautkrebs entwickelt sich oft über Jahrzehnte. Viele heutige Erkrankungen gehen auf UV-Schäden in Kindheit und Jugend zurück – Zeiten, in denen Sonnenschutz oft vernachlässigt wurde.
- Bessere Diagnostik: Die frühere und häufigere Erkennung durch moderne Hautkrebsvorsorge führt statistisch zu höheren Fallzahlen.
- Risikokompensation: Menschen, die Sonnencreme benutzen, neigen dazu, länger in der Sonne zu bleiben, was das Risiko durch zu hohe UV-Dosis wieder erhöht.
Fazit: Sonnencreme schützt – aber nur in Kombination mit einem vernünftigen Verhalten in der Sonne.
5. Risiken von Sonnencremes – was ist zu beachten?
Mögliche Risiken:
- Alte Sonnencremes (älter als 12 Monate nach Öffnung) können chemisch instabil werden – insbesondere bei Octocrylen-haltigen Produkten.
- Hormonähnliche Effekte: Einzelne Studien deuten auf hormonelle Wirkungen bestimmter Filter (wie Oxybenzon) hin, jedoch meist in Tierversuchen oder bei unrealistisch hohen Dosierungen. Für den Menschen ist das Risiko bei sachgemäßer Anwendung als sehr gering einzuschätzen.
- Umweltaspekte: Einige Filter stehen im Verdacht, Korallenriffe zu schädigen – insbesondere in tropischen Gewässern. In einigen Regionen (z. B. Hawaii, Palau) sind bestimmte Sonnencremes daher verboten.
Verbrauchertipp: Wer empfindliche Haut hat oder sich um Umweltaspekte sorgt, kann auf mineralische Sonnencremes ohne chemische Filter zurückgreifen.
6. Was ist der beste Sonnenschutz? – Mehr als nur Eincremen
Ein wirksamer Schutz vor Hautkrebs und Lichtschäden besteht aus einem gesamtheitlichen Konzept:
- Mittagssonne vermeiden (11–15 Uhr)
- Schatten suchen, besonders bei hohem UV-Index
- Schützende Kleidung (Hut, Sonnenbrille, langärmlige Kleidung)
- Sonnencreme als Ergänzung – großzügig auftragen, regelmäßig nachcremen, besonders nach dem Schwimmen oder Schwitzen
Richtige Anwendung: Erwachsene benötigen etwa 30–40 ml Sonnencreme für den ganzen Körper – das entspricht etwa zwei gehäuften Esslöffeln. Weniger Auftragen reduziert den Schutz exponentiell!
Fazit: Sonnencreme schützt – aber nur richtig verwendet
Die Behauptung, Sonnencremes seien grundsätzlich gefährlich oder krebserregend, hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Vielmehr ist belegt, dass ein konsequenter UV-Schutz – inklusive Sonnencreme – das Risiko für Hautkrebs deutlich reduziert.
Die größten Risiken liegen nicht in der Sonnencreme selbst, sondern im sorglosen Umgang mit Sonne und in der Verwendung alter, ungeeigneter Produkte. Wer sich informiert, neue Cremes verwendet, auf gute Inhaltsstoffe achtet und das eigene Sonnenverhalten anpasst, profitiert eindeutig von den Vorteilen moderner Sonnenschutzmittel.
Hinweis: Dieser Artikel dient der gesundheitlichen Aufklärung und ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Hautveränderungen oder Fragen zu individuellen Hauttypen wenden Sie sich bitte an einen Dermatologen.